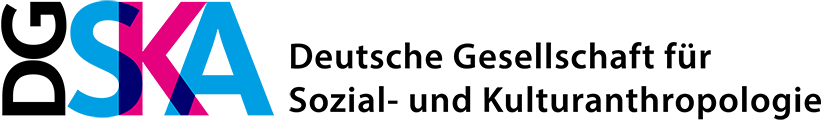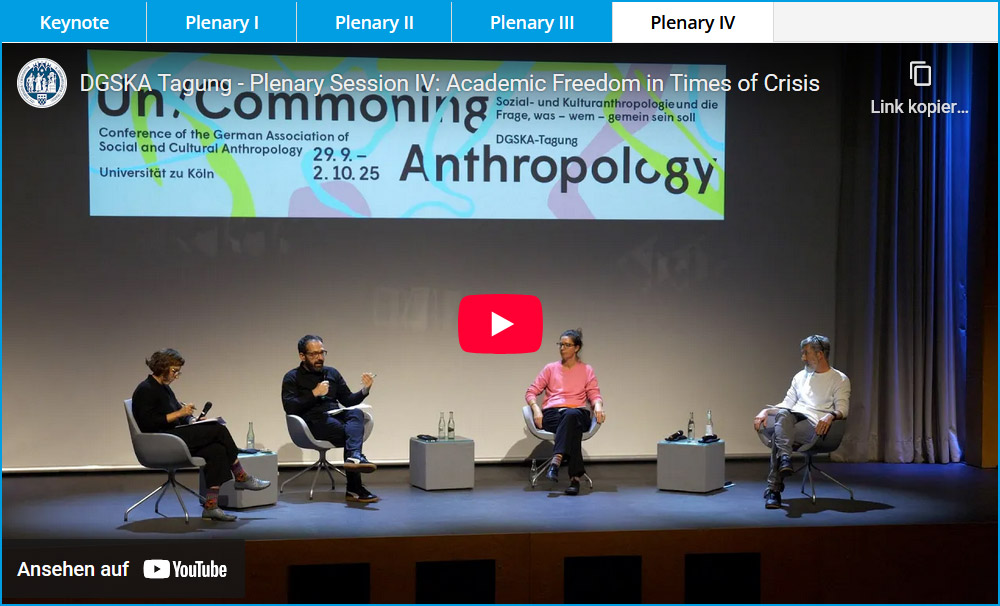Über die DGSKA
Die Deutsche Gesellschaft für Sozial- und Kulturanthropologie (DGSKA) – bis 2017 als Deutsche Gesellschaft für Völkerkunde (DGV) bekannt – ist die zentrale Fachvertretung für Ethnologinnen und Ethnologen im deutschsprachigen Raum. Sie dient als Plattform für wissenschaftlichen Austausch, fördert den Nachwuchs und vertritt die Interessen des Fachs in der akademischen Welt sowie der breiten Öffentlichkeit.
Weiter unter PROFIL
Über unser Fach
Während sich das Fach in Deutschland ursprünglich als „Völkerkunde“ etablierte, tragen mittlerweile alle Forschungseinrichtungen, Universitäts-Institute und -Studiengänge im deutschsprachigen Raum „Ethnologie“ bzw. „Sozialanthropologie“ und/oder „Kulturanthropologie“ im Namen. Ethnologie (ethnos – altgriechisch: Volk) stellt dabei begrifflich die Untersuchung und den Vergleich unterschiedlicher (ethnischer) Gruppen in den Vordergrund, während die Bezeichnungen „Sozial“- und „Kulturanthropologie“ die Erforschung des Menschen (altgriechisch: anthropos) in seinen sozialen und kulturellen Bezügen akzentuieren.
Mehr über UNSERE DISZIPLIN
Wozu Ethnologie
Anlässlich des World Anthropology Day startet hier am 19. Februar 2026 eine Interviewserie mit dem Titel „Wozu Ethnologie?/ Why Anthropology Matters“.
Aktuell
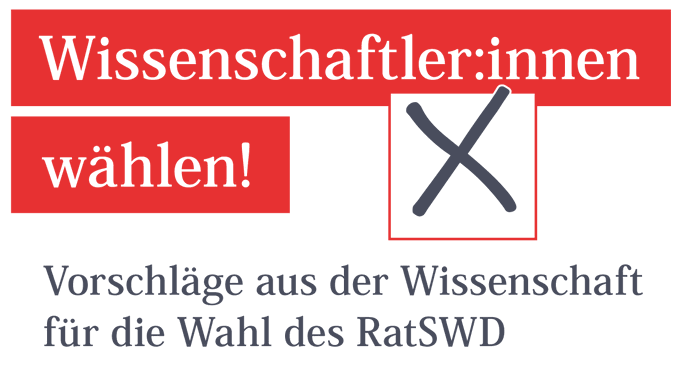
Wahl des RatSWD
Vom 2. bis 29. März 2026 wird der Rat für Sozial- und Wirtschaftsdaten (RatSWD) gewählt. Der RatSWD nimmt eine zentrale Rolle in der Weiterentwicklung der Forschungsdateninfrastruktur in Deutschland ein
Webinar-Reihe „The Ethics of Academic Cooperation in Contexts of Human Rights Violations“ startet
Wir starten eine Webinar-Reihe über „The Ethics of Academic Cooperation in Contexts of Human Rights Violations“. Die nächste Veranstaltung findet am 8.12. um 17 Uhr statt.
Verleihung des DGSKA-Dissertationspreises 2025
Auf der Mitgliederversammlung am 1. Oktober in Köln wurde wieder der Dissertationspreis der Fachgesellschaft vergeben.
Stellungnahmen
Weiterer Appell an den Bundestag zur Resolution zum Schutz jüdischen Lebens
Der wichtige und notwendige Kampf gegen Antisemitismus darf nicht zu Lasten von grundgesetzlich verbürgten Grundrechten gehen. Der Bundestag plant die Verabschiedung einer entsprechenden Resolution in Kürze
Appell zur geplanten Resolution zum Schutz jüdischen Lebens in Deutschland
Der Vorstand der DGSKA hat einen Appell an die Abgeordneten des Deutschen Bundestages zur geplanten Resolution zum Schutz jüdischen Lebens in Deutschland mitunterzeichnet.
Zur Ausladung von Nancy Fraser an der Universität zu Köln
Angesichts der Ausladung von Nancy Fraser von der Albertus-Magnus-Professur verweisen wir auf unser Statement zur Wissenschaftsfreiheit
Die letzte DGSKA-Tagung fand in Köln vom 29.9. – 2.10.25 zum Thema „Un/Commoning Anthropology“ statt. Auf der Tagungsseite finden Sie das Programm sowie Videos von den Plenarveranstaltungen:
Mitteilungen der DGSKA
 Heft 57 der „Mitteilungen der Deutschen Gesellschaft für Sozial- und Kulturanthropologie“ 2024 ist erschienen.
Heft 57 der „Mitteilungen der Deutschen Gesellschaft für Sozial- und Kulturanthropologie“ 2024 ist erschienen.
Die aktuelle und ältere Ausgaben können Sie als PDF herunterladen.
Sie finden sie in unserem Online-Archiv.
Arbeits- und Regionalgruppen
Arbeits- und Regionalgruppen bieten innerhalb der DGSKA ein Forum zum wissenschaftlichen Austausch über bestimmte Themen, Aspekte oder Regionen. Die Richtlinien für Arbeits- und Regionalgruppen der DGSKA finden Sie hier (PDF).