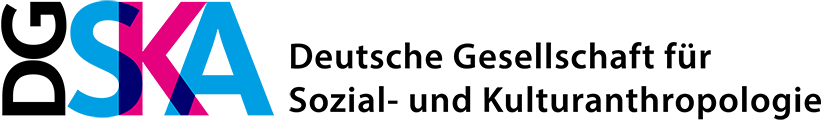Wer erhält die Mär vom edlen Wilden? Gegen die Diskreditierung einer gesamten Disziplin
Mit großem Befremden haben wir den Artikel „Die Mär vom edlen Wilden“ gelesen, der am 17. Oktober 2016 in der Süddeutschen Zeitung unter der Sparte „Wissen > Ethnologie“ veröffentlicht wurde. In diesem Text nimmt der Autor, Christian Weber, einen kürzlich erschienenen Bildband des früheren Modefotografen Jimmy Nelson zum Anlass, über Fragen von Authentizität und die Repräsentation von Tradition in einer globalisierten Welt nachzudenken.
Laut Weber versammelt Nelson in seinem Band Fotografien von Menschen aus „Stammesgesellschaften“, wie er sie bereits in der 2014 erschienenen Reihe „Before they pass away“ darstellte. Mit Blick auf die breite Kritik an Nelsons „ebenso prächtigen wie kitschigen Aufnahmen“ bemerkt Weber dabei sehr richtig, dass das Einfordern einer „angeblich oder tatsächlich fehlenden Authentizität“ das zentrale Anliegen eines solchen Fotoprojekts – zumindest bei wohlwollender Interpretation – verfehle: Als „traditionell“ kategorisierte Kleidungsstile und Artefakte seien zu allen Zeitpunkten der Menschheitsgeschichte eine Form der Inszenierung und kulturellen „Erfindung“. Sie stellten „in der Gegenwart konstruierte kulturelle Symbole“ dar, die „in die Vergangenheit zurückprojiziert [werden], um die kollektive Identität zu festigen.“
Nicht nachvollziehbar ist dann jedoch, dass Weber im weiteren Verlauf des Artikels einen Bogen zur Ethnologie schlägt und zu einer umfassenden Negativkritik an der Disziplin ausholt. Ohne einen solchen Bezug an dieser Stelle bereits explizit zu machen, seien es laut Weber insbesondere Ethnologinnen und Ethnologen, die ein anhaltendes Interesse am Leben von „kleinen Völkern (…) am Rande der Gesellschaft“ hätten und diese als „starke und harmonische Gemeinschaft stolzer Menschen“ darstellten. Hierdurch würden sie die „Projektionen zivilisationsmüder Europäer“ selbst mit immer neuer Nahrung füttern und komplett ausblenden, dass es in ‚indigenen‘ Gesellschaften – ebenso wie in ‚westlich-modernen‘ Gesellschaften – Ungerechtigkeiten und Spannungen gebe, die zu sozialer Benachteiligung, Verwerfungen und Ängsten führten.
Weber stützt seine negative Einschätzung des Fachs Ethnologie vor allem darauf, dass sich die Disziplin – vorgeblich – bis heute vorwiegend auf den kulturrelativistischen Ansatz von Franz Boas stütze: Dieser argumentierte in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, „dass jede Kultur nur aus sich selbst heraus zu verstehen und sie in ihren Werten und Normen von außen nicht zu beurteilen sei“. Unerwähnt lässt Weber in diesem Zusammenhang jedoch, dass es die Ethnologie selbst war, die ab den 1970er bzw. 1980er Jahren – nicht zuletzt im Rahmen postkolonialer Debatten und mit Blick auf Globalisierungsprozesse der Gegenwart – eine zunehmend kritische Perspektive auf die eigene Fachtradition, und damit auch auf kulturrelativistische Positionierungen, eingenommen hat. Auch kommt es ihm nicht in den Sinn, dass gerade der kritisch-differenzierte Blick auf gesellschaftliche und politisch-ökonomische Zusammenhänge – in untrennbarer Verbindung mit dem Bemühen, „Praktiken aus der inneren Logik [von] Gesellschaften zu erklären“ – zum zentralen Arbeitsverständnis der Disziplin gehört.
Es mag sein, dass es in der Ethnologie einzelne Fachvertreterinnen und -vertreter gibt, die bestimmte soziale und kulturelle Phänomene unserer immer komplexer werdenden Gegenwart idealisieren. Auch mögen einzelne Kolleginnen und Kollegen eine primär kulturrelativistische Argumentation vertreten und ihren Fokus darauf richten, bestimmte Bedeutungs- und Praxiszusammenhänge aus der Innenperspektive heraus zu erklären. Das willkürlich-eklektische Herausgreifen von solchen Einzelbeispielen – oder aber aus dem Zusammenhang gerissenen Einzelbefunden – negiert jedoch, dass gerade innerhalb des Fachs Ethnologie konsequent eine Auseinandersetzung über diverse Positionierungen und Theorieansätze geführt wird und dass die Disziplin mit dieser Fähigkeit zur Selbstkritik eine wichtige Stellung innerhalb des sozial- und kulturwissenschaftlichen Arbeitsgefüges einnimmt. Es ist zudem wenig hilfreich, einen mittlerweile fast 100 Jahre alten Theorieansatz ohne weitere Einbettung in die vorhergehenden und nachfolgenden Fachdebatten auf die gesamte Arbeit der heutigen Disziplin zu projizieren.
Die Ethnologie hat in den letzten Dekaden zu zahlreichen Themen des sozialen, kulturellen und politisch-ökonomischen Wandels in verschiedenen Teilen der Welt Stellung bezogen und aus einer nicht-eurozentrischen, postkolonial informierten Perspektive gezeigt, dass sich die scharfe Trennung zwischen ‚traditionellen‘ und ‚modernen‘ Gesellschaften heute nicht länger aufrechterhalten lässt. Auch hat sich das Fach als eine Disziplin positioniert, die ihre eigenen theoretischen und methodologischen Grundlagen konsequent reflektiert und mit diesem Ansatz genau für diejenige Flexibilität und Innovationskraft steht, die Weber auch für das Leben indigener Gemeinschaften in einer globalisierten Welt postuliert. Schließlich werden mit Hilfe der ethnologischen Perspektive Lösungsansätze für ganz praktische Fragen und Herausforderungen formuliert, die das Zusammenleben in einer durch Mobilität, Konflikte und zunehmende Ungleichheiten gekennzeichneten Gegenwart prägen.
Mit der verkürzten Argumentation des Artikels sehen wir das Anliegen von kompetentem Journalismus nicht eingelöst, gründlich recherchieren und – mitunter durchaus polemisch zugespitzte – Diskussionsthesen differenziert belegen zu wollen. Warum die Süddeutsche Zeitung das Forum für einen solchen Text – und damit die Diskreditierung eines gesamten Fachs – bietet, ist für uns nicht nachvollziehbar.
Der Vorstand und Beirat der Deutschen Gesellschaft für Völkerkunde: Prof. Dr. Hansjörg Dilger, Prof. Dr. Birgitt Röttger-Rössler, Prof. Dr. Olaf Zenker, Dr. Anita von Poser, Kristina Dohrn, Dominik Mattes
Siehe auch diesen Blog zum Thema, in dem noch weitere Beiträge zum Artikel in der SZ aufgeführt werden.